Teilprojekte


RP1: Umfassende Modelltestung, Kohortenvergleich und longitudinaler Ansatz
Das theoretische Modell der Forschungsgruppe FOR 2974, das I-PACE Modell, untersucht Kernmechanismen wie Reizreaktivität, Craving, kognitive Verzerrungen und exekutive Funktionen in Bezug auf Suchtverhalten. RP1 nutzt Daten, um frühere Ergebnisse zu replizieren, Kohorteneffekte zu analysieren und Längsschnittdaten zu integrieren. Ziel ist es, Hypothesen zu Prädiktoren, Moderatoren und Mediatoren von Internetnutzungsstörungen (INS) zu testen und Unterschiede in den Stadien der INS zu erforschen. Dies umfasst sowohl Querschnittsvergleiche als auch Längsschnittstudien über drei Jahre, um Veränderungen in affektiven und kognitiven Mechanismen und deren Zusammenhang mit der Symptomschwere zu untersuchen.
Mehr lesen
Projekt Mitarbeitende

RP2: Reduktion des Belohnungswerts bei Computerspielstörung und Kauf-Shoppingstörung – Psychologische Mechanismen und Proof-of-Concept-Studie
Der Einfluss konditionierter Reize spielt eine wichtige Rolle bei Suchterkrankungen, da sie das belohnungsbezogene Verhalten verstärken können, wie der Pavlovian-to-instrumental-Transfer (PIT)-Effekt zeigt. Selbst wenn Belohnungen nicht mehr verfügbar sind, beeinflussen diese Reize weiterhin das Verhalten. Eine Proof-of-Concept-Studie soll nun die Wirksamkeit eines modifizierten Cognitive Bias Modification (CBM) Ansatzes untersuchen, bei dem suchtrelevante Reize mit negativen Konsequenzen verknüpft werden, um deren Belohnungswert zu reduzieren.
Mehr lesen
Projekt Mitarbeitende

RP3: Verschiebung von belohnungsgetriebenen zu zwanghaften Verhaltensweisen: Die Rolle einer verminderten Sensitivität für Bestrafung bei Computerspielstörung und Pornografienutzungsstörung
Computerspiel- und Pornografienutzungsstörungen zeichnen sich durch fortgesetztes Verhalten trotz negativer Konsequenzen aus, wobei bisher die Bestrafungssensitivität vernachlässigt wurde. Diese beschreibt die adaptive Unterdrückung eines Verhaltens als Reaktion auf negative Konsequenzen und kann sich bei suchthaften Verhaltensweisen verändern. Eine Studie untersucht nun die Bestrafungssensitivität bei Personen in verschiedenen Stadien dieser Störungen sowie bei Kontrollpersonen mittels fMRT und Ecological Momentary Assessment, um die neuralen und verhaltensbezogenen Korrelate zu bestimmen. Dabei wird auch die Art und zeitliche Kontingenz der Konsequenzen berücksichtigt.
Mehr lesen
Projekt Mitarbeitende

RP4: Automatische und habitualisierte Reizreaktivität bei Computerspielstörung und Pornografienutzungsstörung: Auswirkungen von akutem Stress und Reiz Devaluation auf subjektive, verhaltensbezogene, psychophysiologische und neurale Korrelate
Reizreaktivität und Craving sind zentrale Mechanismen süchtigen Verhaltens, die durch Stress verstärkt werden und von automatisierten Gewohnheiten beeinflusst werden können. Diese Studie untersucht individuelle und situative Faktoren, wie Stressreaktivität, Stressanfälligkeit, Habit-Neigung und Glutamatstoffwechsel, als Modulatoren der Reizreaktivität bei Computerspiel- und Pornografienutzungsstörungen. Sie besteht aus drei Teilen: Magnetresonanztomographie (MRT), Ecological Momentary Assessment (EMA) und Laboruntersuchungen, um die neuralen und behavioralen Aspekte der Reizreaktivität und Habits zu erfassen. Ziel ist es, die Rolle von Stress und neuronalen Gewohnheiten bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung von Suchtverhalten zu klären.
Mehr lesen
Projekt Mitarbeitende
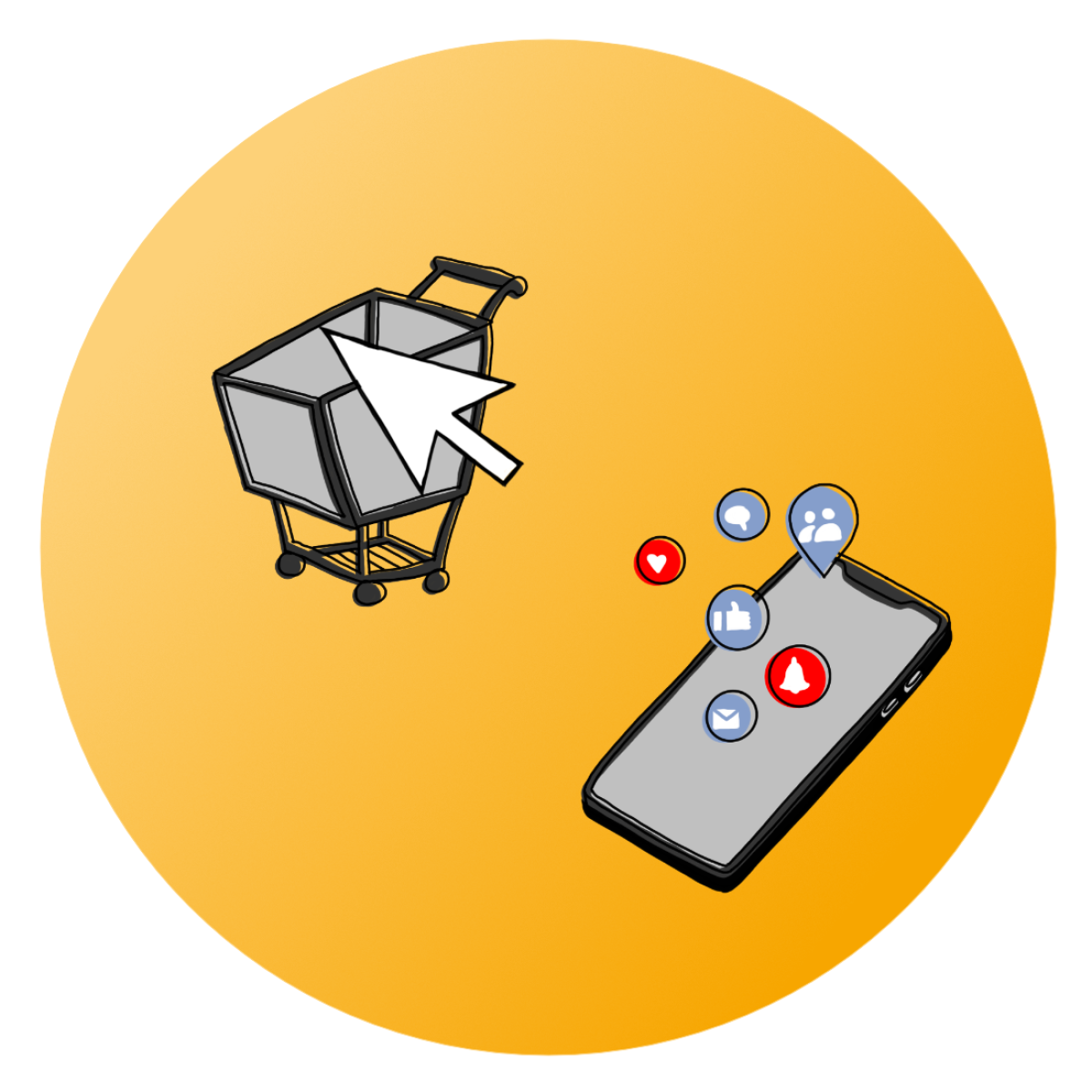
RP5: Alltagsstress, Aufmerksamkeitsverzerrungen und Inhibitionskontrolle bei der Kauf-Shoppingstörung und der Soziale-Netzwerke-Nutzungsstörung
Laut dem I-PACE Modell sind affektive Reaktionen auf suchtbezogene Reize, Aufmerksamkeitsverzerrungen und reduzierte Inhibitionskontrolle zentrale Mechanismen bei Verhaltenssüchten wie Kauf-Shoppingstörung (KShS) und Soziale-Netzwerke-Nutzungsstörung (SNN). Stress verstärkt diese psychologischen Prozesse. RP5 untersucht in der zweiten Förderperiode die Rolle von Stress bei KShS und SNN im Alltag und führt Verhaltenstests im Labor durch, um Aufmerksamkeitsprozesse und Inhibitionskontrolle zu analysieren. Dabei werden auch mögliche Geschlechtseffekte berücksichtigt.
Mehr lesen
Projekt Mitarbeitende

RP7: Untersuchung von in-game Craving und spielimmanenten Faktoren bei Computerspielen und Online-Glücksspielen im seminatürlichen Setting und biofeedback-geleitetem Cue-ExposureTraining
RP7 untersucht spielimmanente Faktoren bei Computerspiel- und Online-Glücksspielstörungen und zielt darauf ab, Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Interaktionen zwischen beiden Störungen aufzudecken. Ein Schwerpunkt liegt auf der Modifikation suchtspezifischer Reaktionen durch biofeedback-geleitetes Cue Exposure Training (CET).
Mehr lesen
Projekt Mitarbeitende
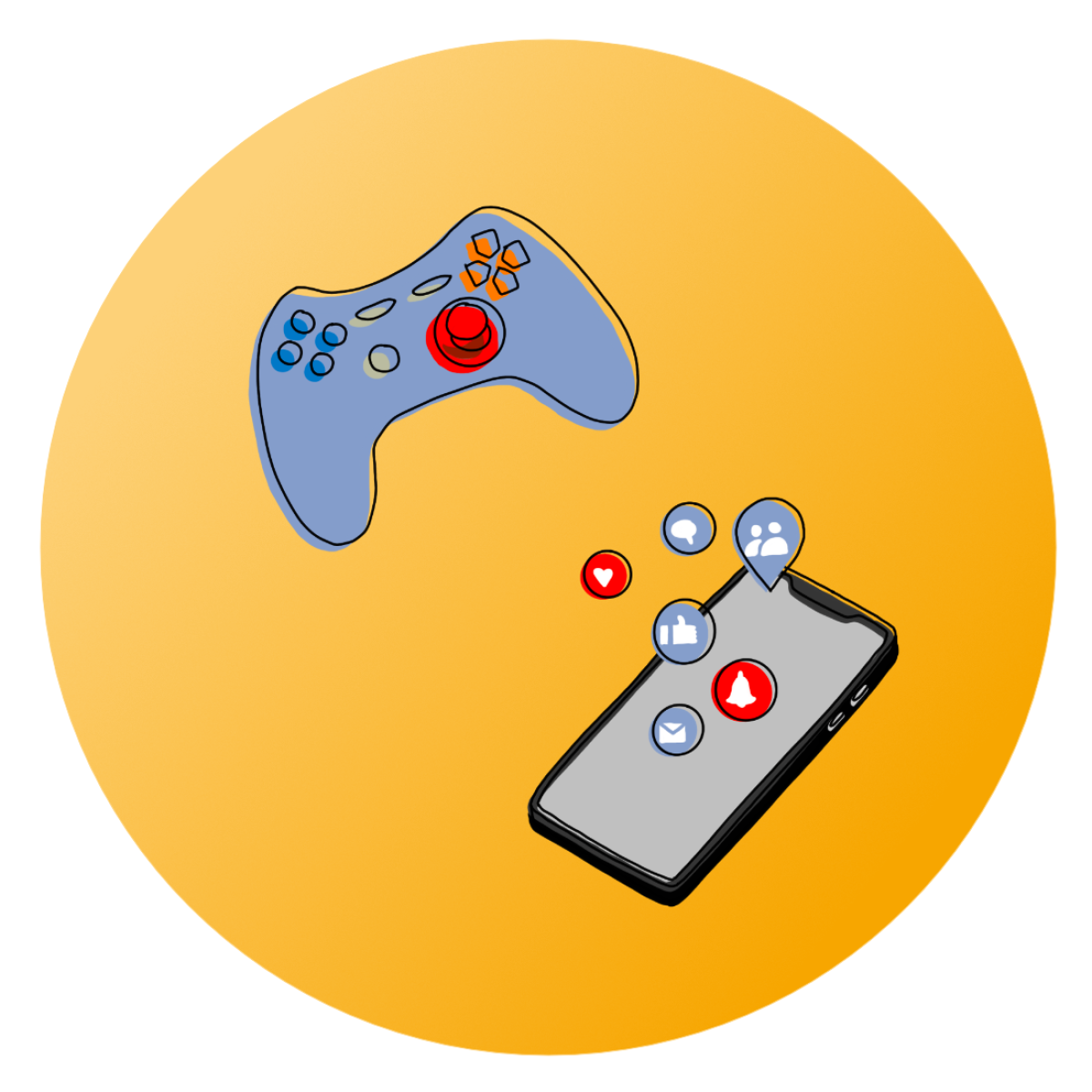
RP8: Training des emotionalen Arbeitsgedächtnisses und Modifikation kognitiver Verzerrungen bei Soziale-Netzwerke-Nutzungsstörung und Computerspielstörung
RP8 untersucht explizite und implizite Kognitionen bei Substanzkonsumstörungen und Verhaltenssüchten wie sozialen Netzwerken und Computerspielen, einschließlich Nutzungserwartungen, Emotionsdysregulation und Inhibitionskontrolle. Die Studie zielt darauf ab, die Wirksamkeit von emotional working memory training (eWMT) und Cognitive Bias Modification (CBM) auf diese Kognitionen zu überprüfen. Erwartet wird, dass eWMT stärker auf explizite Kognitionen und CBM stärker auf implizite Kognitionen wirkt, wobei die Effekte in einem Labor- und einem erweiterten Heimtraining untersucht werden.
Mehr lesen
Projekt Mitarbeitende
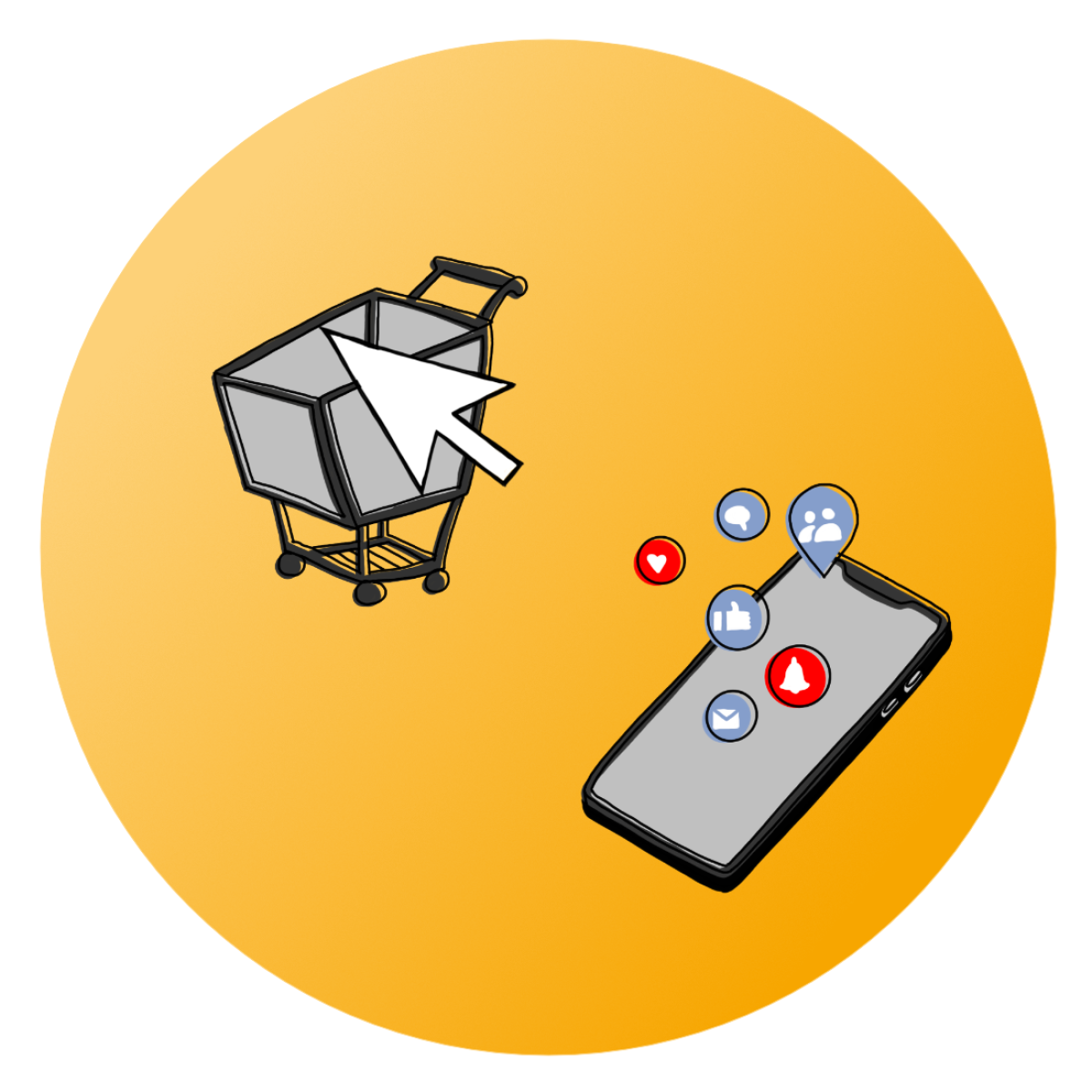
RP10: Reizreaktivität und Verlangen bei der Kauf-Shoppingstörung und der Soziale-Netzwerke-Nutzungsstörung: Neurale Korrelate, Aufmerksamkeitsbias und medienspezifische Aspekte
Reizreaktivität und Craving sind zentrale Mechanismen bei Substanzkonsum- und Verhaltenssüchten. Ein neues Cue-Reactivity-Paradigma der FOR2974-Forschungsgruppe zeigt, dass distale Cues Reizreaktivität und Craving bei verschiedenen Internetnutzungsstörungen auslösen können. In RP10 wird dieses Paradigma genutzt, um die neuralen Korrelate der Kauf-Shoppingstörung und der Soziale-Netzwerke-Nutzungsstörung zu untersuchen und die Ergebnisse mit früheren Studien zu vergleichen, um ein umfassendes Bild der spezifischen Internetnutzungsstörungen zu zeichnen.
Mehr lesen
Projekt Mitarbeitende

RP11: Geschlechtsspezifische Aspekte bei affektiven und kognitiven Mechanismen der Computerspielstörung und der Pornografienutzungsstörung
RP11 untersucht geschlechtsspezifische Mechanismen bei Computerspielstörung und Pornografienutzungsstörung, wobei das entwickelte Cue-Reactivity-Paradigma und die modifizierte Iowa Gambling Task verwendet werden. Erste Ergebnisse zeigen, dass distale Reize bei männlichen Betroffenen Craving auslösen können. RP11 vergleicht nun die Reaktionen bei weiblichen Teilnehmerinnen in vier Gruppen, um geschlechtsspezifische Unterschiede zu analysieren und qualitative Aspekte wie Krankheitsrepräsentationen und medienspezifische Inhalte zu erforschen.

