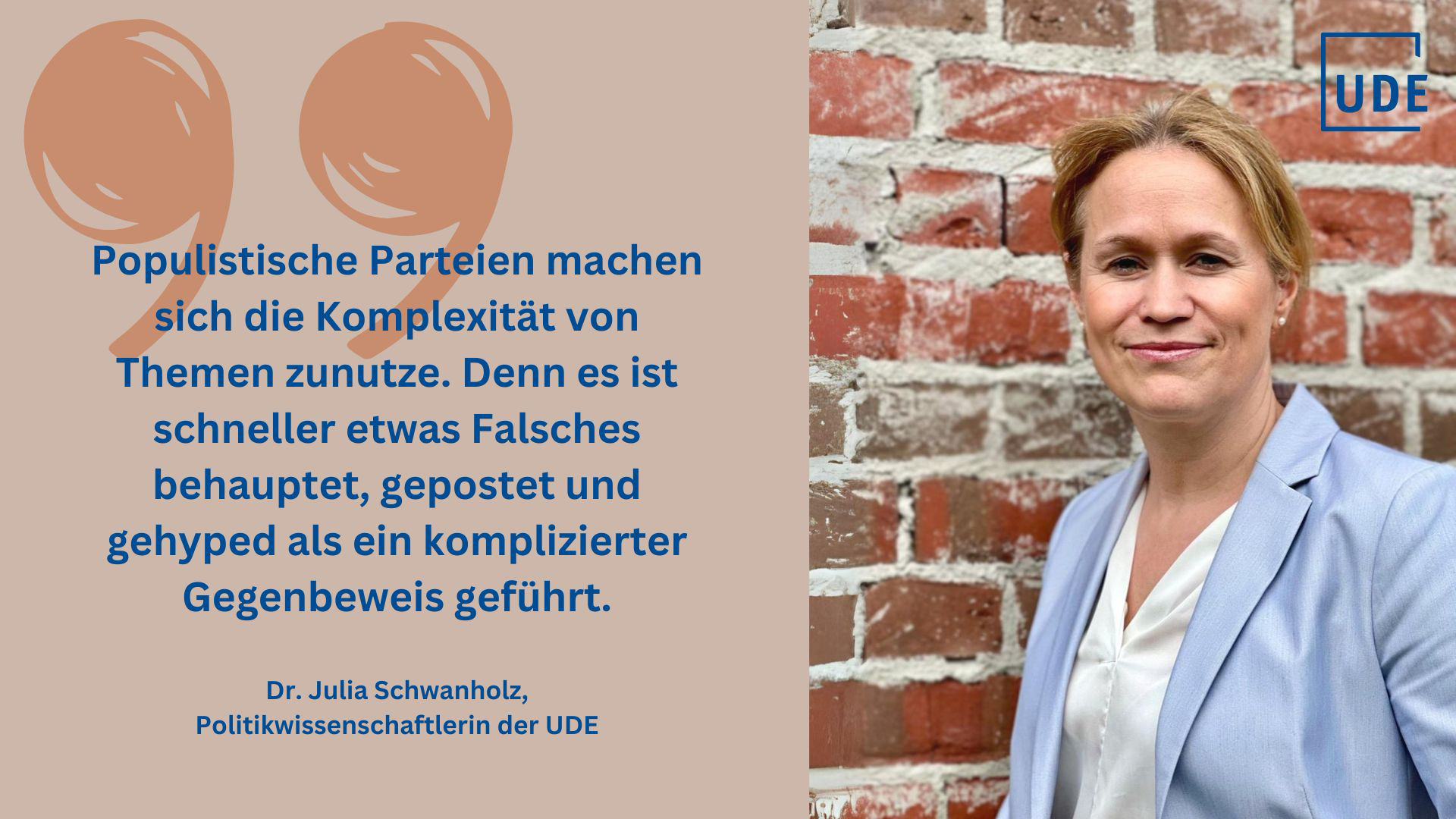
Dr. Julia Schwanholz im Interview
Demokratie in digitalen Zeiten
- von Ulrike Bohnsack
- 03.06.2024
Politiker:innen posten auf den Social-Media-Kanälen. Bürger:innen informieren sich im Netz oder beteiligen sich politisch über Plattformen. Die Digitalisierung spielt für die Demokratie eine immer größere Rolle. Über einige Entwicklungen haben wir mit Politikwissenschaftlerin Dr. Julia Schwanholz gesprochen.
Frau Schwanholz, mit Blick auf die EU-Wahlen am 9. Juni: Warum nutzen euroskeptische bzw. extreme Parteien Neue Medien besser als andere?
Euroskeptische Parteien sind populistisch. Und populistische Parteien arbeiten mit Abgrenzung, Ausgrenzung, Zuspitzung und Verkürzung, um ihre Botschaften zu setzen und Aufmerksamkeit zu erzeugen. Soziale Medien sind da ein guter Nährboden, weil sie ja genau so angelegt sind: textlich und audiovisuell möglichst schnell sein, dafür inhaltlich kurz und knapp bleiben.
Allerdings ist unsere Welt und die komplexe Wirklichkeit eben nicht schwarz-weiß. Die meisten (politischen) Themen brauchen Raum für eine differenzierte Argumentation. Für nahezu jedes Thema gibt es verschiedene Positionen und Perspektiven. Diese anzuerkennen, zu diskutieren und informiert zu entscheiden ist eine anstrengende Aufgabe und ein langwieriger Prozess.
Genau das ist aber das Wesen von Politik. Und genau hier prallen verschiedene Welten aufeinander: Die von Ihnen benannten populistischen Parteien machen sich die Komplexität zunutze. Denn es ist schneller etwas Falsches behauptet, gepostet und gehyped als ein komplizierter Gegenbeweis geführt. Die Aufregungsökonomie im Netz ist vor einer Richtigstellung längst zum nächsten Thema weitergezogen.
Auch der Bundeskanzler ist seit kurzem auf TikTok. Müssen Politiker:innen tatsächlich dort präsent sein?
Niemand muss natürlich in Sozialen Medien aktiv sein. Da dort heutzutage aber bestimmte soziale Gruppen am besten zu erreichen sind, sollte man auch keine Plattform kategorisch ausschließen. Es ist hier eine Abwägung zwischen Ethik, Regeln und Inhalten. Wir wissen beispielsweise, dass besonders junge Menschen – also die Altersgruppe U30 – TikTok intensiv nutzen und sich dort auch zunehmend politisch informieren. Wir wissen auch, dass TikTok eine Plattform ist, die von einem chinesischen Konzern betrieben wird. Damit geht einher, dass mit Nutzer:innendaten anders umgegangen wird, als es unsere EU-Standards vorsehen.
Gewichtet man nun also die Regeln des Datenschutzes und der Datenethik höher, müsste man sich gegen eine Beteiligung in diesem Videonetzwerk entscheiden. Dann aber ließe man junge Menschen mit dem Content, den sie täglich erhalten, allein.
Wie schon gesagt, beherrschen Populisten und Extremisten ihre Zielgruppenansprache oftmals sehr gut. Die Algorithmen tun ihr Übriges und eine rechtliche Prüfung findet ja auch nicht immer wirksam statt. Demokratinnen und Demokraten sollten daher zumindest versuchen, eine positive Kraft im Internet zu sein, auch wenn das leichter gesagt als getan ist.
Welche demokratischen Prozesse lassen sich ins Internet verlagern?
Die digitale Demokratie gibt es schon seit den 1990er Jahren. Vor allem Angebote zur Online-Partizipation haben sich seitdem enorm ausdifferenziert. Sie lassen sich hier kaum aufzählen. Problematisch ist daher weniger das Angebot, als vielmehr die Beteiligung in Zahlen. Obschon eine virtuelle Beteiligung bequemer wäre, steigen die Zahlen gegenüber analogen Verfahren nicht signifikant. Erklärend für eine hohe Beteiligung ist meist das zu entscheidende Sachthema; auch sind es bestimmte Akteure, die besonders gut für ihre Anliegen mobilisieren können.
Doch weil die Bilanz insgesamt so ernüchternd ist, erscheint mir eine gute Verbindung digitaler und analoger Formate zur Einbindung und Beteiligung am besten zu sein. Wir nennen das hybrid und blended democracy, also eine Mischung verschiedener Verfahren, in denen sich Bürger:innen online etwa in Foren diskursiv beteiligen können, um so eine analoge, repräsentativ-demokratisch zu treffende Entscheidung „von außen“ vorzubereiten oder mit einem Stimmungsbild vorab zu bereichern.
Und wie stehen Sie zu Online-Wahlen?
eVoting ist ein vieldiskutiertes Thema, das aktuell in Deutschland noch an rechtliche Grenzen stößt. Es mag durchaus einige Vorteile geben, etwa Inklusion (Absenkung der Zugangsbarrieren) und Effizienz (Verringerung von Fehlern bei der Stimmabgabe und -auszählung).
Besonders interessant finde ich die Frage, ob eVoting tatsächlich die Wahlbeteiligung erhöhen würde. Aber die Nachteile und Bedenken überwiegen derzeit (noch) klar: Es geht dabei vor allem um Sicherheitsmängel (Cyberattacken), Exklusionsgefahren (digital divide und technische Zugangsbarrieren) und Wahlrechtsgrundsätze (Wahlgeheimnis).
Estland ist das einzige mir bekannte Land, wo man seine Stimme aktuell online abgeben kann. Demnächst, so hat es das estnische Parlament kürzlich beschlossen, ist dies sogar noch einfacher per Handy möglich. Dies gilt allerdings noch nicht für die anstehende EU-Wahl, sondern wird voraussichtlich erst im Herbst wirksam. Pilotversuche gab es auch schon in der Schweiz und Norwegen. Sie haben aber gemischte Erfahrungen mit eVoting gemacht und halten nur teilweise daran fest bzw. experimentieren noch weiter damit.
In Deutschland gibt es eVoting bisher nur an Hochschulen. Damit auch ein neuer Bundestag digital gewählt werden könnte, müsste das Bundeswahlgesetz durch eine parlamentarische Mehrheit verändert werden. Allerdings sehe ich das nicht in absehbarer Zeit, weil die Bedenken noch deutlich überwiegen. Demokratisches Vertrauen ist ein hohes Gut, das man nicht herausfordern sollte, nur weil es technisch möglich ist. Estland ist ein Sonderfall und geht hier seinen eigenen Weg als digitaler Vorreiter.
Post-Views: 8005
