RIRA Publikationen
RIRA
Publikationen
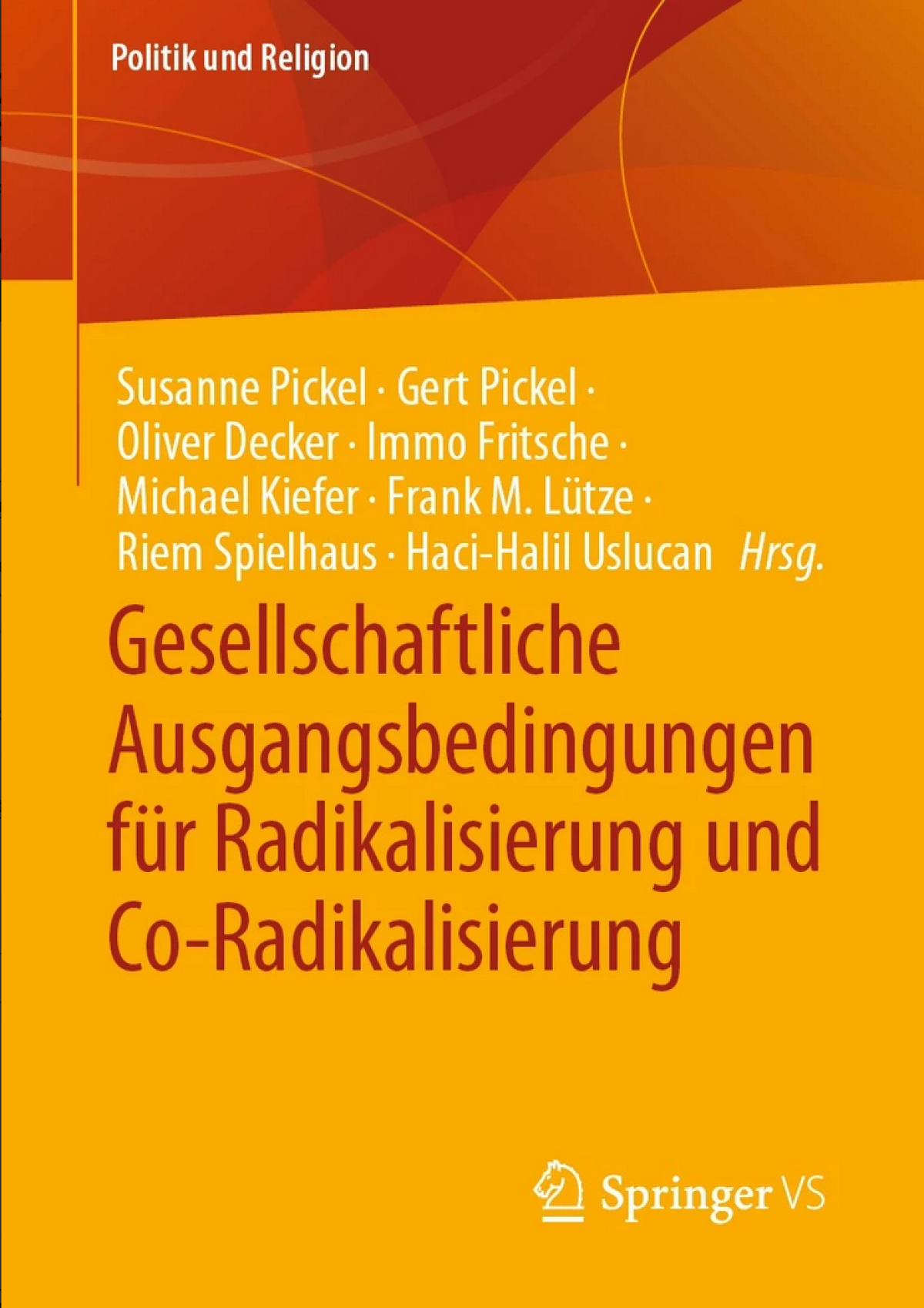
Gesellschaftliche Ausgangsbedingungen für Radikalisierung und Co-Radikalisierung
Spätestens mit den Debatten zu einer zunehmenden Polarisierung der deutschen und anderer europäischer Gesellschaften rückt die Frage nach Prozessen der Radikalisierung in den Blick. Neben individuellen Radikalisierungen sind es vor allem gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die für die Radikalisierung, manchmal sogar ganzer Gruppen, verantwortlich zeichnen. Im vorliegenden Buch werden unter Einbezug unterschiedlicher Perspektiven Prozesse der Radikalisierung und damit verbundenen Co-Radikalisierung auf rechtsextremer und muslimischer Seite untersucht und diskutiert.
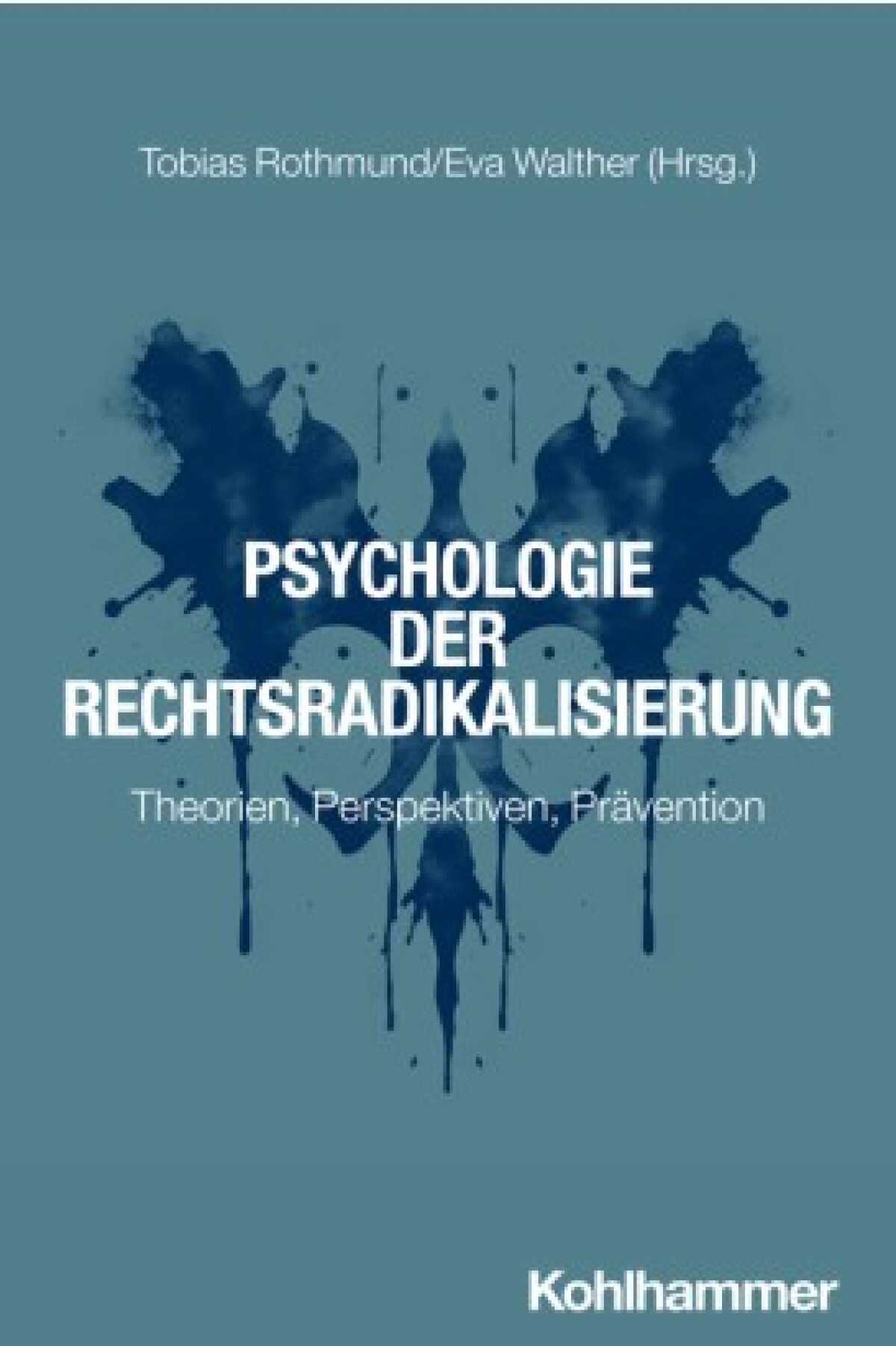
Gruppenbasierte Kontrolle und Rechtsradikalisierung
In: Psychologie der Rechtsradikalisierung: Theorien, Perspektiven, Prävention, hg. von tobias Rothmund und Eva Walther. Stuttgart: Kohlhamer.

The we—sum of its parts or something else? On the philosophical and psychological foundations of social identity and its continuity
How could the idea of continuous identity be compatible with the fact that people live in social spheres (groups) which are subject to constant change? Taking an interdisciplinary approach, this article analyzes what is meant by social and collective identity in ordinary language, psychology, and philosophy. By comparing the ideas of the Social Identity Approach, Social Representations Theory, and Identity Process Theory with Vincent Descombes’ Puzzling Identities, a work in analytic philosophy, the article addresses the fundamental problem of how identity continuity could be possible despite social change. In particular, both the changing material composition of groups and the idea of identity formation in fluid meta-contrast comparisons prove to be major obstacles to continuity. It is discussed how these obstacles might be overcome by the social psychological notions of stable prototypes or representations as well as philosophical ideas of portraying collectives as legal persons, political agents, or general will.

Jugend in der Krise – Überforderung, Bewältigung und Radikalisierungspotenziale
Jugendliche stehen in dem Ruf, besonders radikal zu sein. Medial erregt derzeit die Studie „Jugend in Deutschland“ Aufmerksamkeit, in der sich ein Rechtsruck junger Menschen ablesen lässt. Auch die Debatten um „Krawallnächte“, in denen Jugendliche sich zu Hochzeiten der COVID-19 Pandemie eskalative Auseinandersetzungen mit der Polizei lieferten oder Diskurse über Jugendliche, die ins Ausland reisen, um sich der Terrormiliz „Islamischer Staat“ anzuschließen, prägen das Bild einer „radikalen“ Adoleszenz. In diesem Beitrag zeichnen wir eine doppelte Belastung aus den allgemeinen Herausforderungen des Heranwachsens und den spezifischen gesellschaftlichen Spannungen für Jugendliche nach. Wir erläutern, inwieweit sich aus dieser Doppelbelastung Radikalisierungspotenziale ergeben.
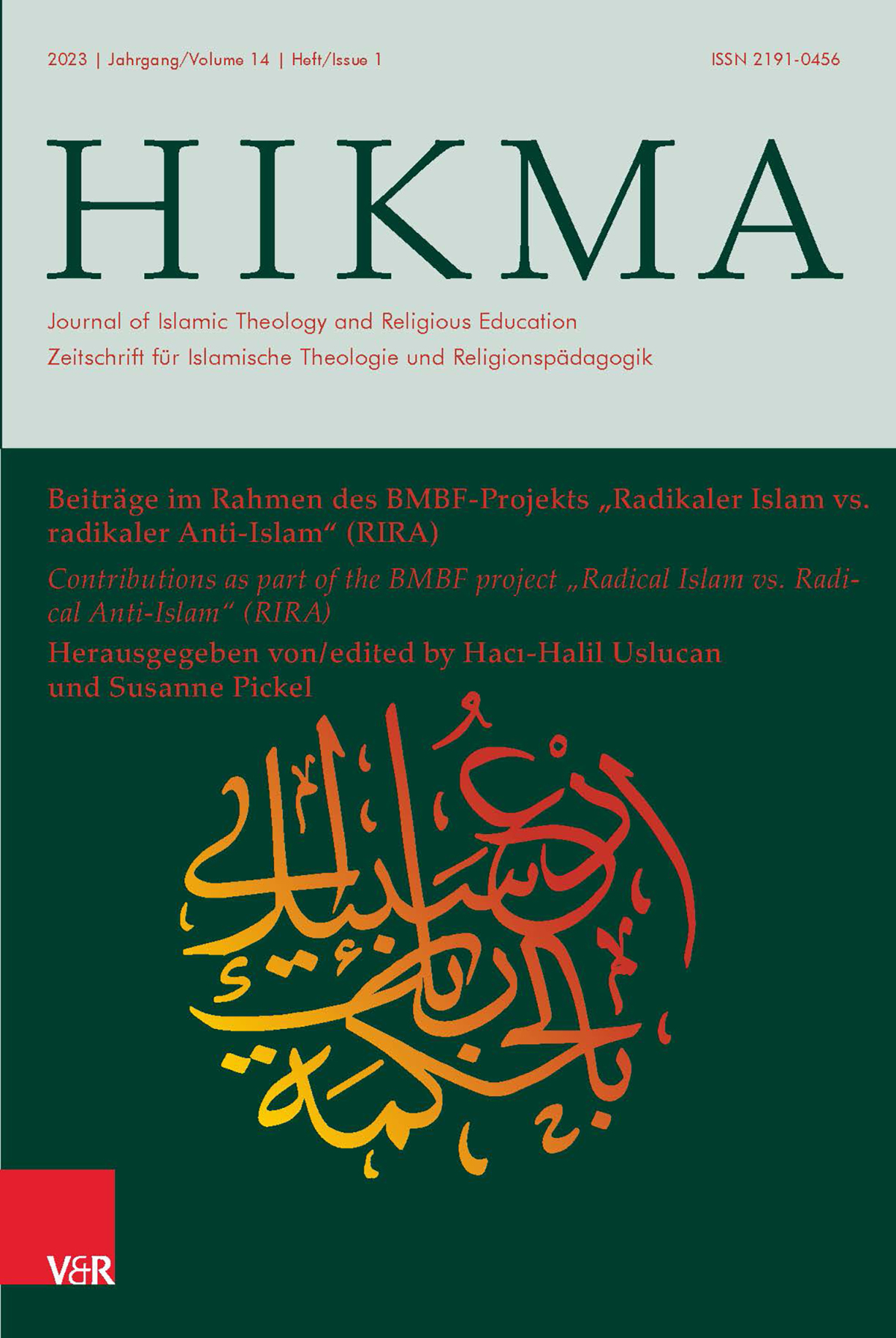
The ABC of Stereotypes Among Muslims and Non-Muslims in Germany
In an empirical, social-psychological survey with open-ended responses, Muslims and non-Muslims in Germany (N = 202) reported what they perceived to be common and socially shared stereotypes about what is “typical” for Muslims in Germany and for non-Muslim Germans. We coded the reported stereotypes according to the Agency, Beliefs, and Communion dimension scheme (ABC). Across both Muslim and non-Muslim sub-samples, non-Muslim Germans were perceived as more agentic and more progressive than Muslims in Germany, whereas Muslims in Germany were perceived as less agentic and more conservative. Even though non-Muslim Germans were generally considered as rather cold, the ascribed communion of Muslims in Germany was rated even lower than the communion of non-Muslim Germans. Differential analyses indicate that for Muslim respondents, communion stereotypes about non-Muslim Germans were associated with perceived symbolic threat and intergroup competition. For non-Muslim Germans, however, communion stereotypes about Muslims were positively correlated with perceived similarity (measured via closeness) of both groups and negatively correlated with intergroup status differences. These differential results provide the basis for discussing the role of ingroup status for predicting communion stereotypes towards outgroups.
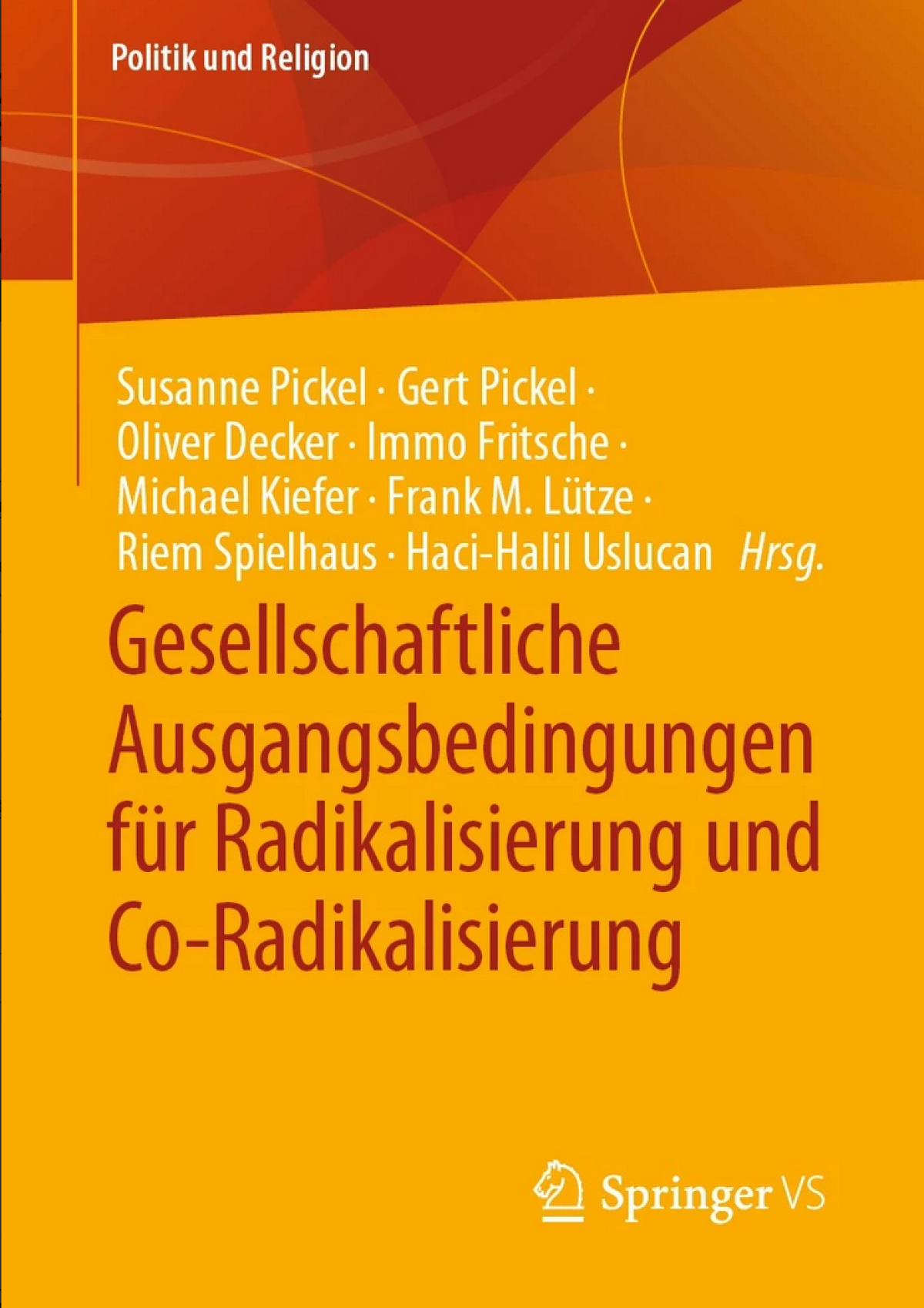
Typisch muslimisch – typisch deutsch? Stereotype im Spannungsfeld religiöser und nationaler Identität
Das einseitig negative und defizitäre Image des Islam sowie die Konstruktion von Muslim:innen als „Fremde“, die der Eigengruppe der Deutschen vermeintlich unversöhnlich gegenüberstehen, lässt die Gegenüberstellung von Muslimisch vs. Deutsch erst zu. Auch wenn man sich von ihrer inhärent exkludierenden und diskriminierenden Haltung distanzieren will – werden hier doch religiöse und nationale Kategorien wie im Vergleich von „Äpfeln und Birnen“ vermischt – so ist diese Dichotomisierung doch ein funktionierender gesellschaftlicher Code, den es zu analysieren gilt. Wir werden uns in diesem Kapitel detailliert mit dem Spannungsfeld zwischen muslimischen und deutschen Stereotypen beschäftigen. Wir fragen uns, welche vermeintlichen Wesensmerkmale mit den beiden Kategorien verknüpft werden und welchen größeren Bedeutungszusammenhängen diese Eigenschaften zugeordnet werden können. Worin unterscheiden sich die Stereotype über Muslim:innen und Deutsche, inwieweit sind sie aufeinander bezogen und welchen gesellschaftlichen Umgang legen sie im Verhältnis von „muslimisch“ und „deutsch“ stereotypisierter Personen nahe? Ausgehend von den theoretischen Annahmen des „Stereotype Content Models“ analysieren wir häufig genannte Stereotype, kontextualisiert durch die Interpretationen zweier Gruppendiskussionen, unter Einsatz verschiedener Forschungsmethoden.
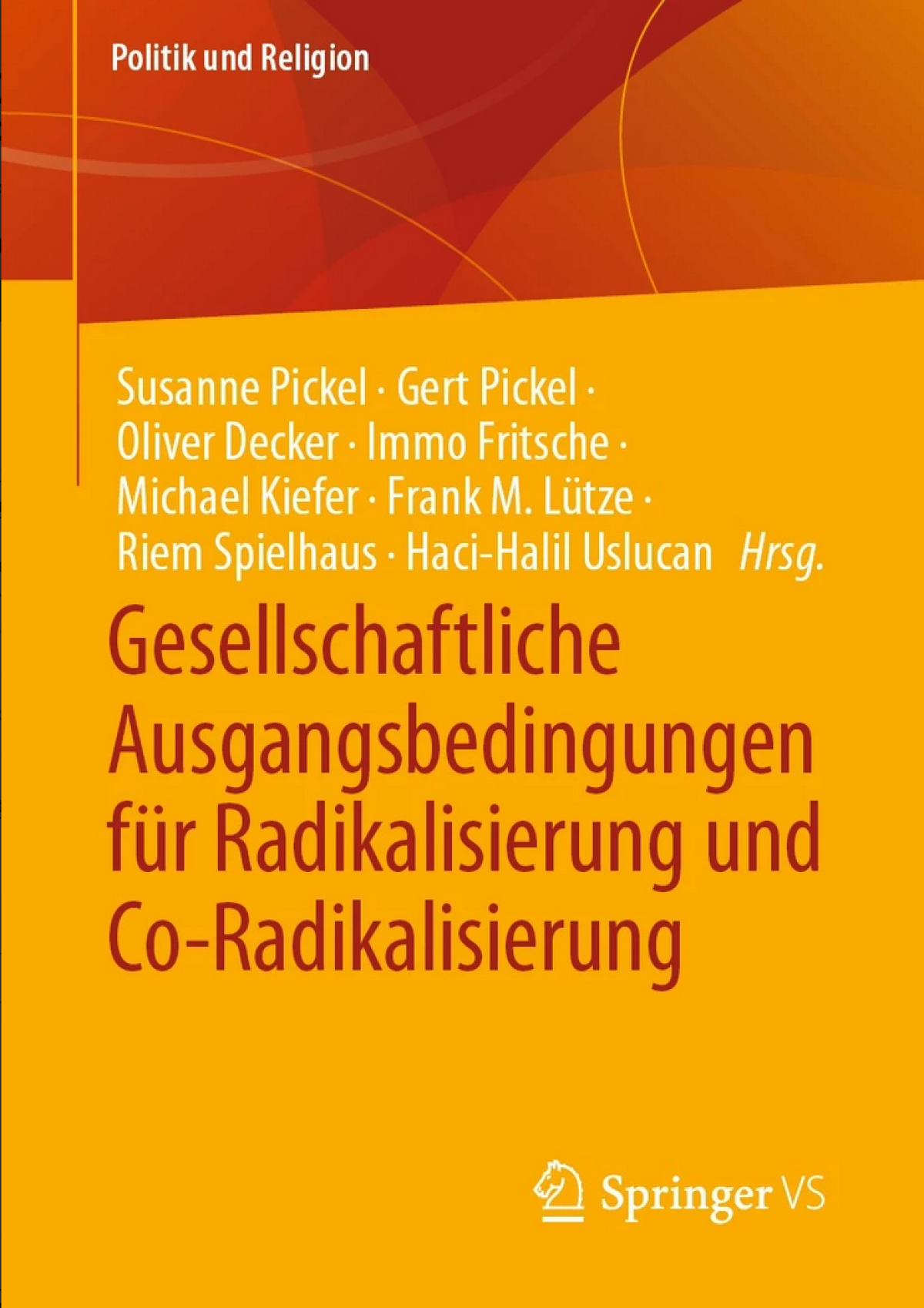
Radikale in Not? Unbefriedigte soziale und psychologische Bedürfnisse als Motivatoren gruppenbasierter Radikalisierung
Unabhängig von der Frage nach der Legitimität von Radikalisierung stellt der so bezeichnete Prozess aus psychologischer Perspektive eine zunehmende Gefährdung des Selbst und der Anderen dar. Radikalisierung beschreibt das Aufgehen von Individuen in radikalen Gruppen und kann in Hass und Gewalt gegen die Mitglieder andersdenkender Gruppen zum Ausdruck kommen. Radikalisierung motiviert dazu, diesen Gegner:innen bzw. Feind:innen nach Möglichkeiten zu schaden und lässt Konflikte eskalieren, aber auch die persönliche Selbstfürsorge, wie die körperliche Unversehrtheit der eigenen Person, mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Auch für Freund:innen und Familie abseits der radikalen Gruppe stellt Radikalisierung häufig eine enorme Belastung dar. Denn vom zerstörerischen Strudel der Aggressionen kann das gesamte Umfeld einer radikalisierten Person erfasst werden. Der Gedanke, dass Radikalisierung für eine besondere Bedürftigkeit oder Notlage radikalisierter Personen stehen könnte, mag dabei nicht als Erstes in den Sinn kommen. Doch im folgenden Beitrag wollen wir die Perspektive einnehmen, Radikalisierung anhand von unbefriedigten sozialen und psychologischen Bedürfnissen zu erklären.

Gesellschaftliche Integration aus psychologischer Perspektive
Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Forschung zu psychologischen Prozessen im Zusammenhang mit gesellschaftlicher Integration. Wir stellen zunächst die kognitiven und motivationalen Grundlagen von Stereotypen, Vorurteilen und Diskriminierung dar und gehen dann auf Modelle zur Erklärung von Intergruppenkonflikten ein, bevor wir uns Intergruppenkontakt und den daraus resultierenden Möglichkeiten für erfolgreiche Integration widmen. Abschließend stellen wir die Forschung zur Akkulturation dar, die die Beteiligung von Migrant*innen und Aufnahmegesellschaft am Integrationsprozess betont.
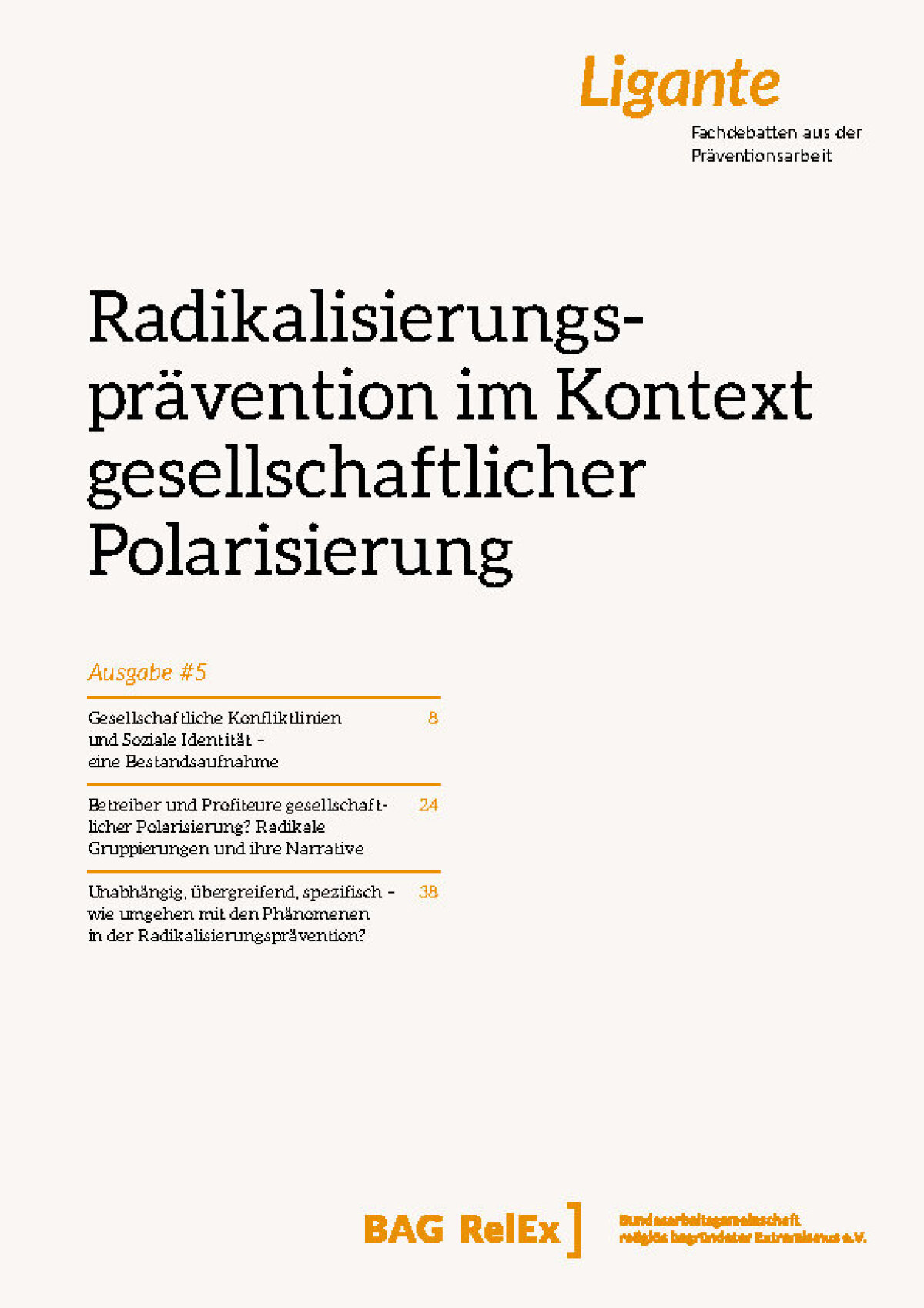
Wir gegen die Anderen. Gruppenprozesse, Bedrohungsgefühle und Konflikte zwischen Gruppen als Treiber von Radikalisierungs- und Polarisierungstendenzen
„Wir sind das Volk!“ – diese Parole wird immer wieder von verschiedenen Gruppen, wie der islamfeindlichen und extremistischen PEGIDA-Bewegung oder der verschwörungsideologischen „Querdenken“-Szene, für sich vereinnahmt. Der Ausruf umfasst das Wir, das kollektiv für eine gemeinsame Sache kämpft. Dieses Wir – in Abgrenzung zu den Anderen als dem gegnerischen Feindbild – ist zentraler gemeinsamer Nenner aller radikalen Gruppierungen. Denn Radikalisierung erfolgt nicht im luftleeren Raum, sondern ist vielmehr ein sozial vermittelter Prozess, bei dem das Denken, Fühlen und Handeln als Teil einer eigenen Gruppe zunehmend an Bedeutung gewinnt. Selbst einsame Wölfe, wie der Rechtsterrorist Anders Breivik, leben zwar sozial isoliert und fühlen sich psychisch dennoch eng mit einer Gruppe verbunden, deren Erfahrungen und Weltverständnis sie teilen.

The interplay between individual and collective efforts in the age of global threats
How does the awareness of and exposure to global challenges affect us as individuals and collectives? How can collectives achieve a shared understanding of these pressing problems and find agreement on how to overcome them? These questions can only be answered based on a deep understanding of how individuals and collectives relate to each other. This special issue revolves around this very relationship. It seeks to combine threat and defense research (which typically focuses on how individuals cope with threat) with collective action research (which typically focuses on how collectives improve their situation). We firmly believe that combining these fields helps us understand the impact of global threats on our societies and their individual members, which will ultimately help address these threats more effectively.

Begegnung im Podcast - Muslimische Jugendliche in Ostdeutschland
Das im Zusammenhang mit RIRA-Forschungsprojekt entstandene und vom Institut für Religionspädagogik in Zusammenarbeit mit dem Verein ZEOK erarbeitete Unterrichtsmaterial "Begegnung im Podcast - Muslimische Jugendliche in Ostdeutschland" ist nun veröffentlicht worden!

